Wenn innere und äußere Mauern fallen
Die Corona-Pandemie hat auch die Diskussionen in den Hintergrund gedrängt, ob die neuen Bundesländer auf dem richtigen Weg sind oder sich die Kluft zwischen den sogenannten alten und den nicht mehr so ganz neuen Ländern sogar weiter öffnet? Vor den Corona-Lockdowns streiften wir mal wieder durch Sachsen, und können nur sagen: Seit der Wiedervereinigung, aber auch in den letzten Jahren, hat sich unglaublich viel getan – und dies zum Guten. Seit 1990 sind die meisten der grauen DDR-Hausfassaden ebenso verschwunden wie die zerbröselnde Infrastruktur. Nicht nur bei Straßen und Eisenbahnstrecken werde ich manchmal ‚neidisch‘, wenn ich sie mit ähnlichen Trassen in Baden-Württemberg vergleiche. Der ‚Soli‘ hat sich auf jeden Fall gelohnt, auch wenn sich im industriellen und gewerblichen Bereich noch Lücken erkennen lassen. Wo es blüht, da ist oft nicht Geld entscheidend gewesen, sondern die Tatkraft der sächsischen Bürgerinnen und Bürger. Diese an sich positive Einschätzung meinerseits scheinen nicht alle Sachsen zu teilen, denn die Bevölkerungszahl ging in den drei Jahrzehnten nach dem Mauerfall von 4,9 Mio. auf knapp über 4 Mio. zurück. In den 1950er Jahren brachten es die Bezirke Leipzig, Dresden und Karl-Marx-Stadt (Chemnitz), in denen zu DDR-Zeiten Sachsen aufgegliedert worden war, sogar auf 5,5 Mio. Einwohner. Der Aderlass scheint sich auch in Zukunft fortzusetzen, dies zeigen zumindest verschiedene Projektionen.

Brücken ermöglichen Mobilität
In Sachsen findet sich im Vogtland bei Pirk eine Autobahnbrücke, die vom Baustart bis zur Fertigstellung 55 Jahre benötigte: Dies ist bei der Elstertalbrücke für Kraftfahrzeuge, auch Pirker Brücke genannt, allerdings nicht den langen Planungs- und Umsetzungszeiten in Deutschland geschuldet, sondern den dunkelsten Tagen in unserer Geschichte. Begonnen wurde der Bau 1938 nach zweijähriger Planungsphase unter der Diktatur der Nationalsozialisten, die Deutschland ins Verderben führten. Bereits 1940 wurde der Bau im Zeichen des Zweiten Weltkriegs eingestellt. Die zwölf Bögen waren zwar fertig, doch bestand in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) bzw. der DDR kein Interesse an einer Vollendung, denn Deutschland war durch die Demarkationslinie zerschnitten, die die SED zu einer immer hermetischeren Grenze ausbaute. Eine zusätzliche Autobahnverbindung zum Klassenfeind lag nun wahrlich nicht im Interesse der sozialistischen Machthaber. So überdauerte die halbfertige Brücke – nur 1,5 km vom DDR-Sperrgebiet entfernt – bis zur Wiedervereinigung, und der Weiterbau begann 1990 unter möglichst weitgehender Erhaltung der Substanz. Sogar die bereits eingelagerten Granitquader für das Verblendmauerwerk konnten eingesetzt werden. Das Bauwerk ist 500 m lang und erhebt sich über der Weißen Elster in 60 m Höhe. Wer heute der A72 folgt, der überquert ganz ohne es zu bemerken ein symbolträchtiges Bauwerk, denn es steht für die Überwindung der NS-Diktatur und des SED-Unrechtsstaats. Hier werden Menschen wieder zusammengebracht und nicht länger getrennt.

In die frühe Zeit der Dampfeisenbahn führen die Göltzsch- bzw. die Elstertalbrücke zurück, die allemal einen Besuch wert sind. Beide Bauwerke waren Teil der Sächsisch-Bayerischen Eisenbahn von Leipzig nach Hof. Noch heute beeindruckt gerade die Göltzschtalbrücke, denn der Besucher kann sie in ihrer Gesamtansicht betrachten: 81 Bögen verteilt auf vier Etagen mit 78 m Höhe – ein gewaltiges Erscheinungsbild! Die Elster- und die Göltzschtalbrücke wurden gemeinsam am 15. Juli 1851 für den Zugverkehr freigegeben. Sachsen war – wie Willi A. Boelcke* schrieb – Mitte des 19. Jahrhunderts nicht nur „der industriereichste Bundesstaat“, sondern auch ein Eisenbahnpionier. So betonte Erich Loest* in Bezug auf die 1839 eingeweihte erste Fernbahnstrecke Deutschlands: „List baute von Leipzig aus die erste wirkliche deutsche Eisenbahn nach Dresden, der Vorgänger von Nürnberg nach Fürth war ja nur eine bessere Straßenbahn gewesen, kurz und tellerflach.“ So nahmen die Eisenbahnkilometer in Sachsen von 1074 im Jahr 1869 bis 1891 auf 2 725 km zu – ein enormer Zuwachs an Transportmöglichkeiten. „Heute verfügt Sachsen über ein Eisenbahnnetz von rund 2.600 km und hat damit“, so die Landesregierung, „die höchste Schienennetzdichte aller Bundesländer.“ Aus den guten Bahn- und Straßenverbindungen kann Sachsen hoffentlich in Zukunft noch mehr Vorteile ziehen.

Von feiner Spitze und schmutziger Kohle
Um 1780 entwickelte sich – aufbauend auf die Tuchmacherei – das Stickereigewerbe, wobei ostindische Tuche in Plauen bestickt wurden. Seit dem frühen 19. Jahrhundert entwickelten sich in Plauen Stickereibetriebe. Zunächst wurde von Hand gearbeitet, ab 1858 kamen zunehmend Maschinen zum Einsatz, und die eigentliche Industrialisierung der Stickerei begann. 16 000 Stickmaschinen waren 1912 in Plauen im Einsatz: Der Höhepunkt der Blütezeit war erreicht. Bereits im Folgejahr standen 40 % der Schiffchenstickmaschinen still, und dies wegen eines modebedingten Nachfragerückgangs. Nach dem Zweiten Weltkrieg lagen Stadt und Fertigungsbetriebe in Schutt und Asche. Erste private Initiativen zur Wiederbelebung der Stickerei endeten 1953 mit der Verstaatlichung im VEB Plauener Spitze. Planvorgaben ersetzten das Gespür für modische Innovationen. Nach der Wende erlebten die verbliebenen – wieder privatisierten – Betriebe ein ähnliches Schicksal wie weite Bereiche der Textilindustrie Jahre vorher in der Bundesrepublik. Der Druck durch weit günstigere Anbieter aus Asien wurde immer größer und verdrängte zahllose deutsche Hersteller. Auch in der Region Plauen haben nur wenige Stickereien in früheren Arbeitsfeldern wie Mode, Bekleidung und Heimtextilien überlebt, doch gibt es Ansätze bei technischen Stickereien für industrielle und gewerbliche Anwendungen.

Nicht ganz so fein und sauber wie bei den Spitzen geht es im Braunkohletagebau zu. In der DDR war die Braunkohle der wichtigste Energieträger, egal ob es um Strom oder Wärme ging. Bis zu 300 Mio. Tonnen wurden jährlich abgebaut und so manches Dorf gleich mit weggebaggert. Dies gilt für Sachsen ebenso wie für das Rheinische Braunkohlerevier, worüber ich in meinem Blog schon mehrfach berichtet habe, so z. B. in ‚Rheinisches Braunkohlerevier: Wenn die Heimat weggebaggert wird – Braunkohleabbau vernichtet Dörfer und schadet der Umwelt‘. Die Zeiten sind längst vorbei als in der DDR für das ‚VEB Gaskombinat Schwarze Pumpe‘ ganze Plattenbausiedlungen in Hoyerswerda hochgezogen wurden. Die kleine Kommune verzehnfachte fast ihre Einwohnerzahl auf über 70 000 Einwohner, wobei ihre erwachsenen Bewohner überwiegend aus Braunkohle Koks, Stadtgas und Strom herstellten. Im Jahr 2020 lag die Stadt nur noch bei rd. 32 500 Einwohnern – 1990 waren es knapp 65 000 gewesen. Eine überaus dramatische Entwicklung, denn während Hoyerswerda die Hälfte seiner Einwohnerschaft seit der Wende verloren hat, boomen Dresden und Leipzig. Hier fehlt eine innovative Regionalpolitik, wie generell in Deutschland: in prosperierenden Städten herrscht Wohnungsnot und Neubauquartiere wachsen ins landwirtschaftliche Umfeld, in anderen Kommunen müssen ganze Wohnblocks abgerissen werden. Unter Umweltgesichtspunkten bleibt heute keine andere Wahl, als auf Kohle zur Energieproduktion zu verzichten, doch müssen dann auch konsequent neue wirtschaftliche Kristallisationspunkte geschaffen werden.

Offene Tore
Allzu leicht vergessen wir in den neuen und alten Bundesländern über der berechtigten Kritik die positiven Seiten der Wiedervereinigung. Und hier stehen für mich an erster Stelle: Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat. Ein Sinnbild dafür sind die offenen Grenzen in Deutschland, aber auch zwischen Sachsen und Polen. Und nicht vergessen dürfen wir, dass sich nicht nur die Tore in Mauern und Zäunen zwischen Staaten geöffnet haben, sondern es wurden auch die Türen aufgeschlossen, hinter denen politische Gefangene und Andersdenkende von der SED eingekerkert worden waren. In Bautzen erinnern Gedenkorte an das Schicksal freiheitsliebender Bürger: Zuerst sperrten die Nationalsozialisten politische Gegner ein, dann auch Opfer des NS-Rassenwahns. Nach Kriegsende übernahm die sowjetische Geheimpolizei Bautzen I, das im Volksmund das ‚Gelbe Elend‘ genannt wurde, bruchlos als Speziallager. Nach Gründung der DDR kam die Deutsche Volkspolizei ans Ruder und setzte politische Gegner fest. Mehr zu Bautzen und dem Unrechtsregime, das die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) errichtete, unter ‚Bautzen I und II: Orte der Qual für Andersdenkende – In der DDR landeten Unschuldige im Stasi-Knast‘.

In Görlitz schlenderten wir über die Grenzbrücke ins polnische Zgorzelec – für uns ein wichtiges Zeichen dafür, dass Europa zusammenwächst. Das Interesse am Leben der Nachbarn auf der anderen Seite der Lausitzer Neiße erschien uns allerdings sehr unterschiedlich ausgeprägt, wie wir in persönlichen Gesprächen erfuhren. Hier ist noch viel zu tun, auch wenn sich Görlitz und Zgorzelec zu einer Europastadt erklärt haben. Bei der Wahl zum Europaparlament im Jahr 2019 lag die AfD bei 32,4 % – anteilsmäßig mehr als CDU und SPD zusammen. Bei der Bundestagswahl 2017 fuhr die AfD 32,9 % der Zweitstimmen ein, die CDU lag bei 26,7 %, Die Linke folgte mit 14 %, die SPD mit 9,3 %, die FDP mit 7 % und die Grünen landeten bei gerade mal 2,9 %. Diese Wahlergebnisse sind auch eine Folge der Perspektivlosigkeit für weite Teile der Bevölkerung. Viele sind weggezogen, manche stecken mehr oder weniger seit der Wiedervereinigung in der Arbeitslosigkeit oder in Beschäftigungsinitiativen fest. In Sachsen stellt die CDU zwar seit der Wiedervereinigung den Ministerpräsidenten, zuerst mit Kurt Biedenkopf, heute mit Michael Kretschmer, doch die Stimmanteile sind geschrumpft. So braucht es seit 2019 eine Dreierkoalition aus CDU, SPD und Bündnis90/Die Grünen als Regierungsbasis.

Zwischen Platte und Altbau
Wie in anderen Bundesländern konzentrieren sich die Bürger in Sachsen mehr und mehr in bestimmten Ballungszentren, was die Situation in anderen Kommunen verschärft, die unter der Abwanderung leiden. Dabei sind bis heute die negativen Auswirkungen der sozialistischen Planwirtschaft zu spüren, so im bereits erwähnten Hoyerswerda. Aber auch Görlitz an der polnischen Grenze hat statt 78 794 im Jahre 1989 heute – trotz Eingemeindungen – nur noch 56 830 Einwohner. Dies wird überdeutlich am noch nicht renovierten Wohnungsbestand. Sehr treffend bemerkte Christian Hunziker in der ‚Welt am Sonntag‘: „Salopp gesagt: Es gibt heute zu viel Stadt für zu wenige Menschen.“ Die SED hatte durch die Festschreibung von Mieten über Jahrzehnte für einen Verfall der innerstädtischen Wohnquartiere gesorgt, denn sie setzte im Sinne des sozialistischen Städtebaus auf Wohnmaschinen in Neubauvierteln. Im Plattenbau sah die SED-Führung das sozialistische Wohnparadies, und die Wohnungsmieten waren niedrig, immer höher aus der sich leerenden Staatskasse subventioniert. In den Innenstädten dagegen unterblieb die Modernisierung, weil diese aus den Mieten nicht erwirtschaftet werden konnte: „Dies erklärt den weitgehend baufälligen Zustand eines großen Teils der Miethäuser“, hieß es bereits 1975 im ‚DDR-Handbuch‘. Die Festschreibung der Mieten auf dem Stand von 1938 erhöhte den Druck auf verbliebene private Haus- bzw. Wohnungsbesitzer, und so hinterließ die SED auch im Wohnungssektor ein Desaster: Zerfallende Wohngebäude in den Innenstädten und wenig ansprechende Plattenbauten am Stadtrand. Wer in unseren Tagen glaubt, Engpässe bei Wohnungen oder steigende Mieten ließen sich durch einen Mietendeckel oder Verstaatlichungen lösen, der hat nichts aus der DDR-Geschichte gelernt!

Wie immer bei Bevölkerungsverschiebungen gibt es nicht nur Verlierer wie Hoyerswerda oder Görlitz, sondern auch Gewinner. Zu diesen zählt die Landeshauptstadt Dresden, deren Einwohnerzahl alleine von 2010 mit 512 702 bis 2020 auf 561 942 anstieg. 1998 lag der Tiefststand nach der Wende im Übrigen bei 452 827 Einwohnern, gegenüber 501 407 im Jahr 1989. In Dresden spielt u.a. der Tourismus eine wichtige Rolle, um Arbeitsplätze zu schaffen und so neue Bewohner anzulocken. Die Corona-Pandemie hinterlässt hier ihre Spuren, doch Kunst und Kultur und die in den Bauten sichtbare Historie werden nationale wie internationale Besucherströme wieder in Gang bringen. Ein Beleg dafür, dass in Dresden und Leipzig verschiedene Wirtschaftssektoren sowie Wissenschaft und Verwaltung vertreten sind, ist auch die Tatsache, dass ein Drittel der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Sachsen in diesen beiden Großstädten ihren Wohnsitz haben. Sachsen liegt bei den Einrichtungen des Bundes ebenfalls nicht schlecht im Rennen, denn dort entfallen auf 100 000 Einwohner 361 Bundesbeschäftigte, in Bayern sind es beispielweise nur 263. Es ist somit eine Mär, dass die neuen Bundesländer bei Bundeseinrichtungen regelmäßig zu kurz kämen.

LPGs als Erosionsbeschleuniger
Das Herz so manches konventionell wirtschaftenden Bauern aus dem deutschen Südwesten dürfte in Sachsen noch immer schneller schlagen, wenn er die weitläufige Feldflur sieht. Hier haben die Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) ihre Spuren hinterlassen. In der Kollektivierungsphase von 1952 bis 1960 wurden die Bauern zur Überführung ihres Landes in die LPGs gezwungen, die den Sozialismus auch bei der Landbearbeitung voranbringen sollten. Mit vielen Mitarbeitern wurde ein großes Rad gedreht, doch im Grunde überwog der Raubbau am Boden und an der Natur – in noch größerem Maße als im Westen, obwohl man das kaum glauben mag. „So arbeiteten fast 50 % der Erwerbstätigen im mittelvogtländischen Kuppenland (Landkreis Plauen) in der Landwirtschaft, in den großen Tierproduktionsbetrieben“, so Willi A. Boelcke*. Die Arbeitsproduktivität war relativ gering, und so erfolgte nach der Wiedervereinigung ein deutlicher Rückgang der Tierhaltung. In Sachsen und den anderen neuen Bundesländern kaufen heute zunehmend Investoren Ackerland auf, die nicht aus der Landwirtschaft selbst kommen, was die Hektarpreise nach oben treibt mit der fatalen Folge, dass kleinere bäuerliche Betriebe keine Flächen mehr zukaufen können. Der Druck von branchenfremden Investoren auf die landwirtschaftlichen Flächen ist auch eine Folge der falschen EZB-Politik, die mit ihrer Nullzinspolitik vielen anderen Geldanlagen die Zugkraft genommen hat.

Nun nochmal zurück zum Landwirt aus dem Südwesten, der sich noch über großzügigere Flächen freuen könnte, wenn er sich von Umweltdiskussionen ferngehalten hat. Die im Westen üblichen Flurbereinigungen haben zwar auch so manches Übel mit sich gebracht, doch die DDR setzte bei der Jagd nach möglichst hohen Erträgen noch mehr auf das Ausräumen der Landschaft. „Das überwiegend kleinteilige Parzellengefüge wich großflächigen Schlägen, die einen fremdartigen Zug ins Bild des mitteldeutschen Agrarraums brachten“, so Siegfried Gerlach*. Die Ertragskraft wurde jedoch nicht wirklich gesteigert und die ökologischen Folgen ließen nicht lange auf sich warten. „Ihre umfangreichen Schläge nämlich, zusammengefügt aus kleinen Flächen, zwischen denen Wege beseitigt und Raine, oft mit Sträuchern besetzt, planiert worden waren, stellten sich der Bodenerosion gegenüber als immer weniger widerstandsfähig heraus. Zwar läßt sich das Phänomen, die vom Menschen über das naturbedingte Maß hinaus beschleunigte Abtragung des Lockerbodens durch Wasser und Wind, vor allem in den sächsischen Lößlandschaften weit in die Vergangenheit zurückverfolgen, eine neue Dimension erhielt es jedoch erst mit der Kollektivierung.“ Nicht nur in der Landwirtschaft setzte die DDR auf gnadenlose Ausbeutung der Natur, sondern auch beim Abbau von Braunkohle oder Uranerz, das aus sächsischen Bergwerken in die Sowjetunion geliefert werden musste, oder bei chemischen Prozessen – davon zeugt noch heute der ‚Silbersee‘ in Sachsen-Anhalt.

Heilen die Wunden langsam?
Nun habe ich die Trennung Deutschlands im Westen erlebt, wenn auch einzelne Besuche zumindest in östlichen Gefilden möglich waren, doch eines ist für mich klar: Die wirklichen Brüche haben unsere Mitbürger in der ehemaligen DDR, in den neuen Bundesländern erlebt. Dies wurde mir in persönlichen Gesprächen früh klar, als die DDR noch bestand, die Grenzen aber schon offen waren. Eine Frau, kurz vor der Pensionierung, erzählte uns auf einer Parkbank beispielsweise, dass sie in der Schuhindustrie tätig gewesen war, doch bereits unmittelbar nach der Wende wollte ‚ihre‘ Schuhe keiner mehr kaufen, und sie hatte volles Verständnis dafür, denn die schwergewichtigen und unmodischen Treter gefielen ihr ebenfalls nicht. Sie war zuversichtlich, dass die Jungen Vorteile aus dem Ende des vermeintlichen Arbeiter- und Bauernstaats ziehen würden, allerdings stand sie nun ohne Job und echte Zukunftsperspektiven da. Daher geht es mir mit Kritik am SED-Regime ganz und gar nicht darum, die Lebensleistung unserer Mitbürger zu schmälern, die qua Geburt im Sozialismus aufwuchsen. Nur wenige konnten sich aussuchen, wo sie ihr Leben starten wollten, wenn man mal von Angela Merkels Vater absieht, der 1954 mit seiner Familie aus Hamburg gen Osten gezogen war. Viele versuchten vor der hermetischen Grenzsicherung noch ‚rüber zu machen‘ – manche bezahlten dies mit ihrem Leben oder landeten im Gefängnis. Der im sächsischen Mittweida geborene Schriftsteller Erich Loest*, der jahrelang als Regimekritiker in Bautzen einsaß, schrieb über das Ende der DDR: „Sicherlich war es vor allem eine Implosion – die DDR hatte sich so gründlich überlebt, die Alten an der Spitze waren unfähig zu jeder Erneuerung, so dass das erste Loch im Zaun nach Westen die Initialzündung brachte, DDR-Urlauber türmten in Massen aus ihren Urlaubszelten am Plattensee.“ Eine konsequentere Aufarbeitung der DDR-Geschichte und der Nachwendezeit hätte ich mir gewünscht, und ich glaube, dass Petra Köpping, SPD-Ministerin in der sächsischen Landesregierung, zu kurz greift, wenn sie sich in ihrem Buch ‚Integriert doch erst mal uns! Eine Streitschrift für den Osten’ im Grunde nur auf die Fehler der Treuhandanstalt und der Politiker im vereinten Deutschland konzentriert und die grundlegenden Übel der DDR nicht in den Blick nimmt, die ja die Auslöser für den wirtschaftlichen Niedergang waren.

Können wir nicht alle, zumindest die Gutwilligen, froh und dankbar sein, dass die innerdeutsche Teilung Geschichte ist und der Eiserne Vorhang, der Europa teilte, wieder hochgezogen wurde? Ich denke schon. Bereits als Schüler und Student habe ich immer auf eine Wiedervereinigung gehofft und an das Ende der Teilung mit friedlichen Mitteln geglaubt. Im besseren Fall wurde ich für meine Veröffentlichungen nur belächelt! Im Namen der Opfer der SED-Herrschaft muss es doch erlaubt sein, das in der DDR geschehene Unrecht auch als solches zu bezeichnen. Dies wurde mir nach einem Besuch in Bautzen wieder sehr klar. Alle zusammen sollten wir in jedem Fall den Blick nach vorne richten und die inzwischen erreichten Verbesserungen und Angleichungen in den Lebensumständen anerkennen. Wer immer nur über Probleme philosophiert, verliert aus dem Blick, dass die gewonnene Freiheit nicht zerredet werden sollte. Und wenn manche Tätigkeiten in den neuen Bundesländern noch geringer bezahlt werden, dann darf nicht unerwähnt bleiben, dass überwiegend in Sachsen und den anderen neuen Bundesländern auch die Mieten geringer sind als in den alten Bundesländern. Abwanderung ist dazuhin nicht nur in Görlitz ein Thema, sondern beispielsweise auch im niedersächsischen Goslar. 1950 lebten in Goslar fast 69 000 Einwohner, heute sind es 50 000 – trotz Eingemeindungen. Irgendwie erinnert dies nicht nur wegen des gleichen Anfangsbuchstaben an Görlitz. Ähnliche Probleme in den neuen und den alten Bundesländern harren einer Lösung, die wir nur gemeinsam erarbeiten und umsetzen können.

Ich hoffe sehr, die Wunden, die die innerdeutsche Geschichte geschlagen hat, vernarben langsam. Und wir müssen alles daransetzen, uns besser zu verstehen. Die aus Bautzen stammende Gruppe ‚Silbermond‘ zeigt da in die richtige Richtung mit ihrem Song ‚Mein Osten‘:
Vergiss nie, wo du herkommst
Ich kenn’ dich, kenn’ dich gut
Mein Osten, mein Osten
An deiner Schönheit kratzt die Wut
Mein Osten, mein Osten
Aufgeben, nicht deine Art …
Mein Osten, mein Osten
Ruppig, herzlich, wie du bist
Mein Osten, mein Osten
Wir kriegen irgendwas hin
Dass deine Ängste nicht gewinnen
Mein Osten
Mag daher auch die AfD in den neuen Bundesländern Erfolge verzeichnen, die ihnen – zum Glück – in anderen Regionen Deutschlands verwehrt wurden, so ist doch die vom früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck benutzte Bezeichnung „Dunkeldeutschland“ völlig unangebracht gewesen, und sie haftet noch immer wie ein falsches Label an den neuen Bundesländern. Warum ausgerechnet das in Rostock geborene Staatsoberhaupt sich so in seinem Vokabular vergriff, das bleibt für mich unerklärlich! Unser ‚jüngster‘ Tripp durch Sachsen – wie auch durch andere ‚östliche‘ Bundesländer – hat für mich verdeutlicht, dass die Menschen dort auf dem richtigen Weg sind. Vieles hat sich verändert, doch 45 Jahre sozialistische Gängelei durch die SED und desaströse Entwicklungen in Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt lassen sich eben nicht in drei Jahrzehnten komplett berichtigen. Vielleicht konnte ich mit diesen wenigen Impressionen, Sie, liebe Leserinnen und Leser, zu einer kleinen Reise durch Sachsen anregen, wenn, ja, wenn endlich die Corona-Pandemie in die Schranken gewiesen werden kann.

Literaturhinweis
* Siegfried Gerlach: Sachsen. Eine politische Landeskunde, Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, Stuttgart 1993
Manchmal sind auch ältere Bücher von Interesse, was sich an dieser wie ein ‚Reader‘ gestalteten Landeskunde zeigt, denn Probleme werden noch offener angesprochen, als es vielfach mit einem gewissen Zeitlablauf geschieht. Liegt das an der ‚political correctness‘? Ich weiß es nicht, aber der Verdacht liegt nahe.
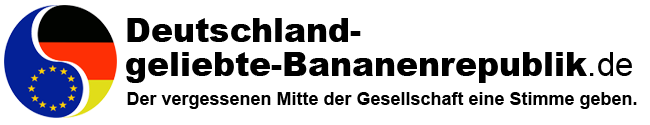

2 Antworten auf „Sächsische Impressionen“